Das Ladenetz für Elektroautos hat im vergangenen Jahr erhebliche Fortschritte gemacht. Besonders bei den leistungsstarken Hyperchargern mit Ladeleistungen jenseits der 150 Kilowatt wurde deutlich aufgerüstet. Dennoch bestehen in Deutschland weiterhin erhebliche Unterschiede in der Abdeckung.
 Der Umstieg auf Elektromobilität scheitert längst nicht mehr an fehlenden Fahrzeugen – nahezu jeder Hersteller bietet mittlerweile eine breite Auswahl an Elektroautos an. Zwei wesentliche Faktoren bremsen jedoch noch viele potenzielle Umsteiger aus: die hohen Fahrzeugkosten (inklusive Wertverlust) und die Ladeinfrastruktur. Sowohl die Netzabdeckung als auch die Kosten für das Laden ließen bislang noch viele Wünsche offen. Die Bundesnetzagentur überwacht jedoch aktiv den Ausbau und setzt alles daran, bestehende Lücken rasch zu schließen.
Der Umstieg auf Elektromobilität scheitert längst nicht mehr an fehlenden Fahrzeugen – nahezu jeder Hersteller bietet mittlerweile eine breite Auswahl an Elektroautos an. Zwei wesentliche Faktoren bremsen jedoch noch viele potenzielle Umsteiger aus: die hohen Fahrzeugkosten (inklusive Wertverlust) und die Ladeinfrastruktur. Sowohl die Netzabdeckung als auch die Kosten für das Laden ließen bislang noch viele Wünsche offen. Die Bundesnetzagentur überwacht jedoch aktiv den Ausbau und setzt alles daran, bestehende Lücken rasch zu schließen.
Ladeinfrastruktur: Zahlen und Fakten
 Ende des vergangenen Jahres gab es in Deutschland rund 121.000 Normalladepunkte und über 33.500 Schnellladesäulen, die eine kombinierte Leistung von 5,72 Gigawatt bereitstellten. Dies entspricht einem Anstieg von 19 Prozent bei den Standardladesäulen und einem beeindruckenden Zuwachs von fast 40 Prozent bei den Schnellladern im Vergleich zu Ende 2023, als es erst 24.000 Schnellladesäulen gab.
Ende des vergangenen Jahres gab es in Deutschland rund 121.000 Normalladepunkte und über 33.500 Schnellladesäulen, die eine kombinierte Leistung von 5,72 Gigawatt bereitstellten. Dies entspricht einem Anstieg von 19 Prozent bei den Standardladesäulen und einem beeindruckenden Zuwachs von fast 40 Prozent bei den Schnellladern im Vergleich zu Ende 2023, als es erst 24.000 Schnellladesäulen gab.
 Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es einen Wermutstropfen: Die Mehrheit der Ladesäulen ist vergleichsweise langsam. So verfügten 28.000 Stationen lediglich über eine Ladeleistung zwischen 3,7 und 15 Kilowatt, während rund 90.000 Ladepunkte eine Leistung von 15 bis 22 Kilowatt boten. Die Zahl der Hypercharger mit einer Leistung von 149 bis 299 Kilowatt stieg von 9.000 im Jahr 2023 auf über 12.000 im Jahr 2024 – ein Wachstum von 40 Prozent. Noch rasanter war der Ausbau bei den Hyperchargern mit mehr als 300 Kilowatt, die um fast 50 Prozent zunahmen. Dies dürfte vor allem Fahrer leistungsstarker Modelle von Audi, Porsche, Lucid oder Lotus freuen, da sie nun noch schneller aufladen können – ein erheblicher Vorteil für lange Strecken.
Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es einen Wermutstropfen: Die Mehrheit der Ladesäulen ist vergleichsweise langsam. So verfügten 28.000 Stationen lediglich über eine Ladeleistung zwischen 3,7 und 15 Kilowatt, während rund 90.000 Ladepunkte eine Leistung von 15 bis 22 Kilowatt boten. Die Zahl der Hypercharger mit einer Leistung von 149 bis 299 Kilowatt stieg von 9.000 im Jahr 2023 auf über 12.000 im Jahr 2024 – ein Wachstum von 40 Prozent. Noch rasanter war der Ausbau bei den Hyperchargern mit mehr als 300 Kilowatt, die um fast 50 Prozent zunahmen. Dies dürfte vor allem Fahrer leistungsstarker Modelle von Audi, Porsche, Lucid oder Lotus freuen, da sie nun noch schneller aufladen können – ein erheblicher Vorteil für lange Strecken.
Regionale Unterschiede bei der Ladeinfrastruktur
 Die Verfügbarkeit von Ladepunkten unterscheidet sich je nach Bundesland erheblich. Die besten Voraussetzungen für Elektroautofahrer bieten Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die jeweils über 22.000 bis 23.000 Normallader sowie zwischen 4.000 und 6.000 Schnelllader verfügen. Weniger gut ist die Situation in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Besonders herausfordernd stellt sich die Lage in den ostdeutschen Bundesländern dar. So gibt es in Thüringen lediglich rund 2.000 Normallader und 1.000 Schnelllader, in Sachsen-Anhalt 1.700 beziehungsweise 800 und in Mecklenburg-Vorpommern gar nur 1.400 Normallader und 500 Schnelllader. Fahrer von Elektroautos und Plug-in-Hybriden müssen hier oft längere Ladezeiten und eine eingeschränkte Infrastruktur in Kauf nehmen.
Die Verfügbarkeit von Ladepunkten unterscheidet sich je nach Bundesland erheblich. Die besten Voraussetzungen für Elektroautofahrer bieten Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die jeweils über 22.000 bis 23.000 Normallader sowie zwischen 4.000 und 6.000 Schnelllader verfügen. Weniger gut ist die Situation in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Besonders herausfordernd stellt sich die Lage in den ostdeutschen Bundesländern dar. So gibt es in Thüringen lediglich rund 2.000 Normallader und 1.000 Schnelllader, in Sachsen-Anhalt 1.700 beziehungsweise 800 und in Mecklenburg-Vorpommern gar nur 1.400 Normallader und 500 Schnelllader. Fahrer von Elektroautos und Plug-in-Hybriden müssen hier oft längere Ladezeiten und eine eingeschränkte Infrastruktur in Kauf nehmen.
Die wichtigsten Anbieter
Der Ausbau der Ladeinfrastruktur geht jedoch unvermindert weiter. Bundesweit gehört EnBW mit rund 8.400 Ladepunkten zu den führenden Betreibern, gefolgt von E.ON mit 4.300 und Tesla mit 3.000 Ladepunkten. Damit entwickelt sich die Elektromobilität in Deutschland kontinuierlich weiter – und das Laden wird immer komfortabler und schneller.
Strom abwärts
H&R Sportfedern für den VW ID.3
 Neue Technik und mehr Leistung im VW ID.3 Pro S
Weitere Modellpflege für den ID.3 im Modelljahr 2025
Neue Technik und mehr Leistung im VW ID.3 Pro S
Weitere Modellpflege für den ID.3 im Modelljahr 2025
 Mehr Leistung und technische Updates
Modellpflege für den 2024er VW ID.4 & ID.5
Mehr Leistung und technische Updates
Modellpflege für den 2024er VW ID.4 & ID.5
 Brüder im Geiste – Videofahrbericht online
Neuer Polestar 3 und 4 im Fahrbericht – So gleich und doch verschieden
Brüder im Geiste – Videofahrbericht online
Neuer Polestar 3 und 4 im Fahrbericht – So gleich und doch verschieden

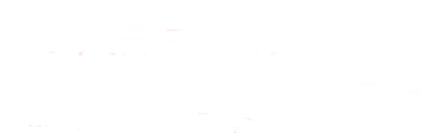






Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar