Die Geschichte des VW Bulli ist in erster Linie eine Liebesgeschichte. Aber wie das in der Liebe nun einmal so ist, ist es eine Geschichte mit Höhen und Tiefen, bei der man noch nicht genau sagen kann, wie sie einmal enden wird. Aber wie sie angefangen hat, das weiß man genau. Ein holländischer VW Importeur hat da seine Finger im Spiel. Alles fing einmal an mit einer dahingekritzelten Skizze, aus der später dann ein schnöder, schlichter Kastenwagen werden sollte, bei dessen Anblick sich ganz gewiss niemand vorstellen konnte, dass daraus einmal ein Kultauto werden würde.
Es gibt wohl kaum ein Auto über das mehr Geschichten und Bücher veröffentlicht wurden als der VW Bulli. Gut, vielleicht der VW Käfer, der ja bekanntlich nicht ganz unbeteiligt ist an der Entwicklung des Bullis, denn schließlich spendete er dem VW Bus zu Beginn seinen Motor und über die ersten Generationen hinweg teilten sich Käfer und Bulli tatsächlich diverse Bauteile. Anfänglich gab es sogar die Überlegung, den VW Kastenwagen auf das selbstfahrende Käfer-Chassis zu stellen, aber das wurde aus Stabilitätsgründen schnell verworfen. Als VW dann 1950 den Transporter vorgestellt hatte, wird wohl niemand ernsthaft damit gerechnet haben, dass der Bulli einmal zum Motor des deutschen Wirtschaftswunders werden sollte und schon gar nicht, dass er einmal zum Kultauto für mehrere Generationen werden sollte und dies 75 Jahre später im Grunde genommen immer noch ist. Das gilt nicht nur für den T1, auch der T2 und der eckige T3 haben ihre Fans ebenso wie die folgenden Generationen mit Frontmotor. Was man nur zu gut verstehen kann, wenn man selber einmal eine Variante des Bullis gefahren hat, egal welche Generation. Der Autor dieser Zeilen hat vom T1 bis zum T3 mehrere Generationen VW Bulli besessen und kann auch auf langjährige Erfahrung mit dem T4 und T5 zurückblicken. Ein T2 oder T3 Camper wäre noch ein bislang unerfüllter Wunsch.
75 Jahre VW Bulli – Eine Liebe auf vier Rädern
Denn die folgende Szene war zu T1 und T2-Zeiten nicht nur ein schöner Traum: Es ist ein lauer Sommerabend. Die Sonne taucht den Himmel in goldene Farben, während eine Gruppe Freunde an einem kleinen Strand zusammenkommt. Inmitten der Szene parkt ein alter VW Bulli, Türen weit geöffnet, Gitarrenklänge wehen in der warmen Luft. Geschichten werden erzählt, Lachen hallt über den Sand. Es ist ein Bild der Freiheit, der Unbeschwertheit – ein Bild, das seit Jahrzehnten Menschen auf der ganzen Welt mit dem Bulli verbinden.
Im Jahr 2025 feiert dieses Symbol einer ganzen Lebensart seinen 75. Geburtstag. Der VW Bulli ist weit mehr als nur ein Transporter. Er ist Weggefährte, Reisepartner, manchmal sogar Heimat auf Rädern. Seine Geschichte spiegelt die Sehnsucht nach Aufbruch und Abenteuer ebenso wider wie den Erfindungsgeist und die Wandelbarkeit von Generationen.
Die Geburtsstunde einer Ikone
Die Entstehung des Bulli ist ein Beispiel dafür, wie aus einer einfachen Idee etwas Großes werden kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg suchte Volkswagen nach neuen Wegen, den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu unterstützen. Der niederländische VW-Importeur Ben Pon hatte 1947 eine Vision: Ein kleines, praktisches Transportfahrzeug auf Basis des VW Käfers, das Händlern, Handwerkern und Betrieben das Arbeiten erleichtern sollte.
Mit einer simplen Skizze begann die Geschichte. Drei Jahre später, im März 1950, rollte der erste Typ 2 – der spätere Bulli – aus dem Werk. Seine Form war klar, seine Aufgabe einfach: Dinge und Menschen von A nach B zu bringen. Doch sein wahres Potenzial zeigte sich schnell – er war mehr als nur ein Nutzfahrzeug. Zu Beginn steckte im Heck ein 24,5 PS Motor, eindeutig zu wenig um die ein oder andere Transportaufgabe zu bewältigen. Die Konstrukteure gaben den Bulli nicht ohne Grund eine Portalachse mit auf den Weg, diese verfügte über eine Untersetzung direkt an den Hinterrädern. Das hebte zwar das Drehzahlniveau, verlieh dem T1 die benötigte Kraft, aber versetzte ihn auch in die Lage, auf unbefestigtem Terrain weiterzukommen als man es vielleicht vermuten würde. Es folgten eine 30, 34, 42 und 44 PS Maschine, die sich der Bulli vom Käfer auslieh. Der T2 startete 1967 dann mit einer 1,6 Liter Maschine mit 47 und später 50 PS, was auf der Autobahn immerhin Reisegeschwindigkeiten von knapp 100 km/h ermöglichte. Es gab ihn aber auch mit der „großen“ Maschine vom VW 411 mit zwei Vergasern, die 62 (Automatik), 66, 68 und 70 PS leistete. So mancher wuchtete einen luftgekühlten Boxer vom VW Porsche 914 in den Motorraum. Oder gleich ein Vierzylinder-Triebwerk aus dem Porsche 912 – auch das gab es. Das Baukastensystem war simpel und offen für diverse Möglichkeiten. Und dann gab es auch noch den Super-Bulli: der Porsche T3 B32 Caravelle dürfte heute wohl der teuerste Bulli von allen sein. Sieben Exemplare sollen davon mal bei Porsche entstanden sein.
Der Weg in die Herzen
Der Bulli überzeugte zunächst durch seine Robustheit und Vielseitigkeit. Handwerker schätzten die Ladefläche, Familien entdeckten den Bus als praktisches Reisemobil. Besonders der T1 eroberte die Straßen Europas vor allem aber die USA und dort als Microbus mit Stoffschiebedach und „Oberlichtern“.
In den 1960er-Jahren wurde der Bulli zum Symbol einer ganzen Bewegung. Junge Menschen, die sich von den starren gesellschaftlichen Normen lösen wollten, fanden im Bulli das perfekte Gefährt für ihren Freiheitsdrang. Bemalt, umgebaut, mit Matratzen, Gitarren und Träumen beladen, fuhren sie zu Festivals, durch Wüsten und über Gebirge. Woodstock, Goa, Marrakesch – der Bulli war dabei.
Er wurde zu einer rollenden Botschaft: Freiheit, Gemeinschaft und das Abenteuer des Lebens.
Evolution eines Klassikers
Sieben Generationen hat der Bulli inzwischen durchlaufen – jede ein Spiegel ihrer Zeit. Der erste T1 (1950–1967) war noch spartanisch, aber charmant. Der T2 (1967–1979) brachte größere Fenster, stärkere Motoren und mehr Komfort. Der Clipper, das Luxus-Modell ist heute fast vergessen, der Silberling ist deutlich populärer und entsprechend stark gesucht. In Brasilien und Mexico machte der Bulli ebenfalls Kariere. Es gab ihn in Varianten sowie T1/T2-Mischformen, die in Hannover weder angedacht, noch gebaut wurden. Ein Teil dieser Bullis wird heute in den USA und den europäischen Märkten zu deutlich günstigeren Preisen angeboten, aber man sollte sich auskennen und sich vielleicht auf jene Exemplare beschränken, die bereits schon im Lande sind. Es könnte sonst eine unliebsame Überraschung geben.
187 Bilder Fotostrecke | 75 Jahre VW Bulli: Vom Kastenwagen zum Kultauto
Mit dem kantigen T3 (1979–1992) wurde der Bulli erwachsener, ohne seinen Charakter zu verlieren. Erstmals gab es Allradantrieb auch für das Serienmodell, perfekte Voraussetzungen für Abenteuer abseits befestigter Straßen. Der T4 (1990–2003) brach mit der Tradition des Heckmotors – Antrieb und Motor zogen nach vorn, was neuen Raum im Innenraum eröffnete.
Der T5 und T6 verfeinerten Technik und führten das Frontmotor-Design weiter, während der aktuelle T7 (seit 2021) sich jetzt mit einem Ford Transporter die Plattform teilt, was in der VW-Bulli-Community nicht auf ein ungeteiltes Echo stößt.
Doch parallel zur Weiterentwicklung der Transporter-Reihe versuchte Volkswagen auch das Erbe zu bewahren. Mit dem ID. Buzz, der 2022 vorgestellt wurde, sollte der Geist des T1 in moderner, vollelektrischer Form bewahrt werden und ausgerechnet ein Hersteller aus China stellte mit dem Skyworth Summer einen Van vor, der deutlich mehr T1 und T2 Spirit verströmte. Wie die Geschichte ausgeht, ist noch nicht ganz klar.
Der Bulli als Kulturgut
Es gibt nur wenige Fahrzeuge, die es schaffen, Emotionen über Generationen hinweg zu wecken. Der Bulli ist eines davon. Er taucht in Filmen, Musikvideos und Werbekampagnen auf – oft als Inbegriff von Freiheit, Abenteuer und einem alternativen Lebensstil. Der Bulli war als Pistenraupe mit Kettenfahrwerk und als Draisine auf Schienen unterwegs. Als Pritsche und Doppelkabine mühte sich der Bulli als Working Class Hero ab, umso erstaunlicher, dass solche Modelle der Generationen T1-T3 bis heute überlebt haben. Der Bäcker, der Schreiner und der Kaufmann an der Ecke hatten einen Bulli, vielleicht als Kastenwagen, vielleicht als Kombi, womit sie dann mit flugs montierter Mittelsitzbank oder Camping-Box für den Familien-Trip ins Wochenende aufbrachen. Bei der Bundeswehr, der US-Army und selbst bei der Schweizer Armee verrichteten die Bullis ihren Dienst. Deutlich friedvoller aber die Karriere als Eiswagen, gern vor allem in der Hochdach-Version. Aber es gab den Bulli nicht nur in „hoch“, es gab ihn auch in lang. Die niederländische Firma Kemperink streckte den Bulli und verpasste ihm einen Spezialaufbau. Damit war er jetzt auch auf den Wochenmärkten als rollender Verkaufsstand unterwegs. Selbst als Renntransporter z.B. für die Formel V sind Bullis mit langem Radstand schon gesichtet worden. Als Transporter für die Toblerone schaffte es der Bulli weltweit als Corgi-Modell im Maßstab 1:43 in die Kinderzimmer und später auch in die Sammlervitrinen. Matchbox, Siku, Wiking, Märklin, Lego und so weiter, sie alle hatten einen VW Bulli – oft gleich in mehreren Versionen über verschiedene Generationen hinweg im Programm. Selbst als guter Onkel half der VW Bulli gerne aus, spendete er doch für den Fridolin nicht nur die Grundidee, sondern gleich auch die komplette Heckpartie.
Szenen mit Bullis am Meer, in den Bergen oder auf Festivals sind aus der Popkultur nicht wegzudenken. The Who hatten einen „Magic Bus“ und DJs bestrahlten ungezählte Beachpartys und VW-Treffen mit coolen Sounds und heißen Rhythmen, oft war ein Samba-Bus die Grundlage für die „rollende Disco“, konnte man dank Schiebedach doch an den Plattentellern stehen und hatte so auch die schwofende Meute besser im Blick. „Roadtrip“ und „Bulli“ – diese beiden Begriffe sind für viele synonym geworden. Übrigens, als der Bulli das Licht der Welt erblickte hieß er nicht Bulli. Seine Fans haben ihn erst dazu gemacht. Am plausibelsten klingt die Erklärung, dass sich bei diesem Auto „Bus“ und „Lieferwagen“ kurz „Bulli“ perfekt vereinen. Volkswagen hat bei den ersten Generationen noch vom Transporter gesprochen, der Samba hieß offiziell „Sondermodell“, wurde in den USA jedoch Microbus gerufen
Weltweit pflegen zahlreiche Fanclubs die Bulli-Tradition. Auf ungezählten Treffen wie dem nicht mehr existenten „VW-Forum“, dem „Maikäfertreffen“, dem „Bulli Summer Festival“ oder dem „Busfest“ in Großbritannien kommen jährlich tausende Liebhaber zusammen, um ihre Fahrzeuge zu präsentieren, Geschichten zu teilen und das Lebensgefühl, das der Bulli verkörpert, weiterzutragen. Volkswagen feierte den 60 Geburtstag des Bullis in Hannover und auch hier wirkte der Autor in der Planung und der Umsetzung mit.
Gut erhaltene oder restaurierte T1-Modelle erzielen heute auf Auktionen Spitzenpreise – teils weit über 100.000 Euro. Für einen T3 mit Porsche-Technik sind sogar über 300.000 Euro aufgerufen worden.
Ein Lebensgefühl auf Rädern
Wenn man den Bulli liebt, liebt man nicht nur ein Fahrzeug – man liebt ein Gefühl. Das Gefühl, jederzeit aufzubrechen. Die Welt aus eigener Kraft zu entdecken. Unterwegs zu sein und dennoch ein Stück Zuhause dabei zu haben.
75 Jahre VW Bulli bedeuten 75 Jahre Geschichten von ersten Urlauben, von improvisierten Camper-Ausbauten, von wilden Abenteuern und ruhigen Momenten am Lagerfeuer.
Und auch wenn sich Technik, Design und Gesellschaft wandeln – der Traum, den Horizont im eigenen Tempo zu erreichen, bleibt bestehen.
Der Bulli ist nicht einfach gealtert. Er ist gereift – und bereit, auch die kommenden Generationen auf ihre Reisen zu begleiten.
Auf die nächsten 75 Jahre, lieber Bulli. Danke, dass du uns immer wieder gezeigt hast, dass der Weg manchmal genauso schön ist wie das Ziel.
Die VAU-MAX-Bulli-Bilder-Schau: Bulli Parade
Ihr "tut Busse"? Wir auch! VAU-MAX zeigt eine kleine Übersicht, was man aus T1,T2, T3, T4 und T5 so alles machen kann!
 Warum ist der so teuer?
364.900 € für einen VW T3 – der teuerste Bulli der Welt
Warum ist der so teuer?
364.900 € für einen VW T3 – der teuerste Bulli der Welt
 Traumhafte Kombination
VW T1 Samba mit Porsche 911-Triebwerk und ganz viel DRIVE
Traumhafte Kombination
VW T1 Samba mit Porsche 911-Triebwerk und ganz viel DRIVE

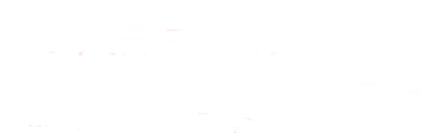


















Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar